Europäer wollen die berühmten Benin-Bronzen nach Nigeria zurückgeben. Doch das Museum dort gibt es noch nicht. Wo werden die Bronzen landen?
Besuch in einer Stadt, die von einer afrikanischen Renaissance träumt.

Es gibt zwei Sehenswürdigkeiten in Benin City, einer staubigen Millionenstadt im Süden Nigerias. Die eine ist eine alte Stadtmauer aus Erde. Sie ist überwachsen mit Gras, dazwischen liegen Abfall und Kot. Manchmal verschwinden Teile der Mauer; die lehmige Erde taugt auch nach fast sechshundert Jahren als Baumaterial.
Die zweite Sehenswürdigkeit ist ein Museum. Es ist rund und rostrot und wurde 1973 gebaut, um die Kulturschätze eines der mächtigsten Königreiche zu zeigen, die es in Afrika je gegeben hat. Viele der Schätze lagen damals in europäischen Museen. Dort liegen sie immer noch. Es dauert kaum fünfzehn Minuten, um durch die Dauerausstellung im Nationalmuseum von Benin City zu gehen.
Benin City ist eine Stadt mit einer grossen Vergangenheit, von der wenig geblieben ist. Doch gerade ändert sich etwas. In Europa denken Museumsdirektorinnen und Politiker laut darüber nach, koloniale Raubkunst zurückzugeben. Der britische Autor Barnaby Phillips, der vor kurzem ein Buch über die Debatte veröffentlicht hat, spricht vom «vielleicht wichtigsten kulturellen Moment in der postkolonialen Geschichte Afrikas».
Was passiert, wenn die Kunstwerke zurück nach Afrika kommen? Eine Gruppe umtriebiger Männer in Benin City träumt davon, dass sich alles ändern wird. Dass Benin City eine Zukunft bevorsteht, so glorreich wie die Vergangenheit – eine Renaissance sozusagen, die auf ganz Afrika ausstrahlen wird.
Doch ist es so einfach?
Wie konnten Unzivilisierte solche Werke schaffen?
Enotie Ogbebor ist so etwas wie der Chefideologe des Traums. Das Studio des Künstlers ist gross wie eine Turnhalle, es liegt mitten in der Stadt, in einem Hochhaus, dessen untere Etagen früher einen Supermarkt beherbergten und aus dessen oberen Etagen nie mehr wurde als ein Rohbau.
Ogbebor ist 52. Er hat nicht nur den festen Glauben, sondern auch die dröhnende Stimme eines Pastors. «Stell dir vor», sagt er, «die Werke von da Vinci, Michelangelo, von Mozart und Beethoven wären für über hundert Jahre aus Europa entfernt worden – wäre die westliche Zivilisation da, wo sie jetzt ist?»
Ogbebor ist Mitglied der Benin Dialogue Group, in der sich Vertreter von zwölf europäischen Museen, der nigerianischen Regierung und des Königshauses von Benin seit 2007 über den Umgang mit Kulturgütern aus Benin City austauschen. Ogbebors Geschichtsverständnis lässt sich an den Wänden des Studios ablesen, daran lehnen seine Werke. Es sind Malereien voll bunter Farbe und Pathos: Szenen am Hof von Benin, eine afrikanische Mona Lisa, das Porträt einer Königinmutter, aus deren Krone Rosenblätter rieseln – als Metapher dafür, dass Menschenhändler und Cyberkriminelle das einst ruhmreiche Benin City in Verruf bringen.
Benin-Bronzen im Linden-Museum in Stuttgart. Britische und deutsche Museen besitzen die grössten Bestände.
Thomas Niedermueller / Getty
«Vor Hunderten von Jahren schufen wir grosse Kunst», sagt Ogbebor. «Eigentlich sollten wir heute noch Grösseres schaffen. Doch wir profitieren nicht vom Können unserer Vorfahren, weil ihre Werke in ausländischen Museen gefangen gehalten werden.»
Im Februar 1897 überfiel eine britische Armee Benin City. Es war eine Racheaktion, wenige Wochen zuvor hatten Soldaten des Königs von Benin über zweihundert Teilnehmer einer britisch geführten Expedition massakriert. Der Strafexpedition gelang es, die Stadt einzunehmen, viele Bewohner und der König flüchteten. Es war das erste Mal, dass das Königreich Benin in seiner tausendjährigen Geschichte fiel.
Im Königspalast fanden die Briten einen Schatz: Elfenbeinzähne mit aufwendigen Schnitzereien, gegossene Metallbüsten, Bronzetafeln, die wie Bilderbücher Szenen aus der Geschichte des Königreichs dokumentierten: Begegnungen mit portugiesischen Soldaten im 15. Jahrhundert etwa. Ein Expeditionsteilnehmer von 1897 schrieb: «Das Haus des Königs ist ein eigentliches Wunder.»
Drei Monate nach dem Fall des Königreichs fand in London die erste Versteigerung von Benin-Objekten statt. Sieben Monate nach der Eroberung stellte das British Museum erstmals Benin-Werke aus, unter anderem dreihundert der Relieftafeln. Die Qualität der Objekte, von denen manche fast fünfhundert Jahre alt waren, löste eine Debatte aus: Wie war es möglich, dass unzivilisierte Afrikaner, die man guten Gewissens kolonisierte, Kunstwerke von solcher Schönheit geschaffen hatten?
120 Jahre nach dem Fall von Benin City gehören die Benin-Bronzen zu den berühmtesten Kunstwerken, die je auf dem afrikanischen Kontinent geschaffen worden sind. Und sie sind Gegenstand einer hoch emotionalen Debatte um koloniale Schuld.
Ein «Verbrechen gegen die Völker»
Im Frühjahr 2018 besuchte Enotie Ogbebor das British Museum – den Ort, wo seiner Meinung nach die Vergangenheit und damit auch die Zukunft seines Volkes eingesperrt ist. Er wanderte durch die Galerie, in der 56 Bronzetafeln hängen und von der Geschichte des Königreichs erzählen. Dann stieg er mit einer Kuratorin in den Untergrund, wo in klimatisierten Räumen jene Objekte lagern, die nicht ausgestellt sind.
Ogbebor sah Hunderte von Werken, aus Metall und aus Elfenbein, aufbewahrt in gepolsterten Behältern. Er sagt, er habe beim Anblick der Objekte die unterschiedlichsten Gefühle gehabt: Stolz ob der Schönheit der Kunst seiner Vorfahren. Trauer über den Verlust. Erleichterung, weil sich die Werke in einem guten Zustand befanden. Vor allem aber, sagt Ogbebor, habe er im British Museum den festen Willen gespürt, die Werke nach Afrika zurückzuholen.
Der Zeitpunkt war günstig. Im November 2017, wenige Monate vor Ogbebors Besuch in London, hatte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Rede vor Studierenden in Burkina Faso gesagt: «Es ist inakzeptabel, dass sich grosse Teile des kulturellen Erbes afrikanischer Länder in Frankreich befinden.» Er wolle innerhalb von fünf Jahren die Bedingungen schaffen, um afrikanisches Erbe dauerhaft oder vorübergehend zurückzugeben. Ein Bericht, den Macron in Auftrag gab, bezeichnet die Aneignung afrikanischer Kulturgüter durch Europäer als «Verbrechen gegen die Völker».
Bald rückten auch die Benin-Bronzen in den Fokus. Mehr als dreitausend von ihnen sind über die Welt verstreut, sie liegen in Museen und Privatsammlungen, niemand kennt ihre genaue Zahl. Die grössten Bestände finden sich in Grossbritannien und in Deutschland, das British Museum allein besitzt über neunhundert Objekte.
Die Bronzen – von denen die meisten aus Messing sind – eignen sich aus zwei Gründen besonders gut als Anker der Debatte um koloniale Raubkunst: Sie sind weltweit bekannte Meisterwerke, und ihr Verlust für Afrika lässt sich mit einem historischen Ereignis verknüpfen – der Plünderung von 1897.
Wenn Enotie Ogbebor über die Restitution spricht, geht es meist um Dialog und Kooperation – zwischen den europäischen Museen, dem Königshaus von Benin City, der nigerianischen Regierung. Doch manchmal redet sich Ogbebor in Fahrt, er sagt dann: «Diese Werke gehören uns. Sie müssen zurückgegeben werden.» Oder: «Wir werden keinen Zentimeter von unserem Recht abweichen.»
Ogbebor und seine Verbündeten sind auf gutem Weg, ihren Kampf zu gewinnen. Vor einem Jahr köpften Black-Lives-Matter-Demonstranten Statuen von Sklavenhändlern oder beschmierten sie mit Farbe. Die Proteste verschafften der Raubkunstdebatte zusätzliche Dringlichkeit. Zuletzt überboten sich europäische Museen und Behörden mit Wortmeldungen zu den Benin-Bronzen. Sie kündigten an, einzelne Objekte zurückgeben zu wollen, oder beschlossen neue Richtlinien, die eine mögliche Rückgabe gestohlener Werke vorsehen. Auch Schweizer Museen wollen die Herkunft ihrer Benin-Objekte abklären.
Am weitesten geht die deutsche Regierung. Ende April veröffentlichte die Kulturstaatsministerin eine Erklärung zum Umgang mit den rund 1100 Benin-Bronzen, die in deutschen Museen liegen. In dem Papier hiess es, man strebe «substanzielle» Rückgaben an. Erste Objekte sollen bereits 2022 nach Nigeria zurückgehen. Für Enotie Ogbebor war die Ankündigung ein Triumph.
Ogbebor hat eine Theorie des Fortschritts, sie geht so: Eine Gesellschaft benötigt das Wissen der Vorfahren, um sich zu entwickeln. Benin City wurden grosse Teile dieses Wissens 1897 geraubt. Deshalb wissen die einfachen Leute in den Strassen der Stadt nicht, welch grossartigen Dinge ihre Vorfahren geschaffen haben. Doch wenn die Bronzen nach Benin City zurückkehren, werden alle sehen und staunen und sich bemühen, Ähnliches zu vollbringen wie die Ahnen. Nicht nur die Künstler, auch die Chirurgen, die Taxifahrer und die Schulkinder. «Es wird ein Wiedererwachen sein», sagt Ogbebor.
Ein ehrgeiziges Museumsprojekt
Am Ort, an dem Benin City wieder erwachen soll, deutet noch nichts auf die Renaissance hin. Es ist ein unbebautes Grundstück gegenüber dem Königspalast, fünf Fussminuten von Enotie Ogbebors Studio entfernt. Gras wuchert wild, eine rissige Mauer begrenzt das Feld. «Hier nicht urinieren», hat jemand hingepinselt.
An dieser Stelle soll ein neues Museum für die Bronzen entstehen. «Edo Museum of West African Art» (Emowaa) soll es heissen, rund 150 Millionen Dollar kosten. Das Projekt ist enorm ehrgeizig, und es hat das mächtigste Argument gegen die Rückführung ausgehebelt.
Die Frage, ob die gestohlenen Bronzen zurückkehren sollen, ist mindestens sechs Jahrzehnte alt, und sie führte bis vor kurzem immer zu der Gegenfrage: Wo sollen denn die schier unbezahlbaren Kunstwerke aufbewahrt werden? Nigerias staatliche Museen sind schlecht finanziert, ihre Angestellten oft schlecht ausgebildet und die Gebäude ungenügend gesichert. In der Vergangenheit verschwanden immer wieder wertvolle Objekte.
Das Nationalmuseum liegt in der Mitte des Kings Squares, im Zentrum von Benin City
Nationalmuseum von Benin City
Standort des geplanten Museums
Theophilus Umogbai ist ein freundlicher Mann, dessen Laune kurzzeitig kippt, wenn er auf den Ruf der nigerianischen Museen angesprochen wird. Der Kurator des Nationalmuseums in Benin City kennt die Vorurteile und die Anekdoten. Zum Beispiel jene über den nigerianischen Staatschef Yakubu Gowon, der 1973 persönlich im Nationalmuseum in Lagos eine Bronzebüste auswählte und sie kurz darauf der Queen beim Staatsbesuch in London schenkte.
Umogbai hat die Geschichten zu oft gehört. «Das ist nicht die Realität», sagt er in seinem engen Büro im Museumsgebäude, das weniger als 500 Meter vom geplanten Emowaa entfernt liegt. In den zehn Jahren, in denen er das Museum in Benin City leite, sei es zu keinem einzigen Diebstahl gekommen.
Tatsächlich ist Umogbais Museum eines der am besten unterhaltenen im ganzen Land. Doch die meisten Bronzen in der Dauerausstellung sind im 20. Jahrhundert angefertigte Kopien. Das prominenteste Exponat ist eine grossflächige Schwarz-Weiss-Fotografie von 1897. Sie hängt am Ende der Ausstellung und zeigt drei britische Plünderer, sie sitzen im zerstörten Königspalast und rauchen. Vor ihnen auf dem Boden arrangiert liegen Dutzende von Reliefplatten. «Schau dir ihre triumphierenden Gesichter an», sagt Umogbai beim Rundgang. Er hat das Bild auch als Anklage aufhängen lassen – und als Erinnerung daran, dass sein Museum weit mehr sein könnte, als es ist.
Doch eine Rückgabe der Bronzen an das Nationalmuseum in Benin City war nie eine Option für die europäischen Museen – das weiss auch Theophilus Umogbai. Er ist wie Enotie Ogbebor Mitglied der Benin Dialogue Group und nimmt an den Gesprächen über die Restitution teil. Er war dort gewissermassen Komplize, als seine eigene Institution ausmanövriert wurde.
Der Kurator sass am Tisch, als der Gouverneur des Teilstaats Edo, dessen Hauptstadt Benin City ist, im Oktober 2018 über die Pläne für ein neues Museum sprach. Godwin Obaseki war 2016 gewählt worden, er galt als ausgezeichnet vernetzt, als integer – und kunstbegeistert. Das Museumsprojekt, das Obaseki präsentierte, würde nicht von der staatlichen Museumsbehörde gesteuert, sondern eine autonome Trägerschaft haben. Diese würde sich auch darum kümmern, das nötige Geld aufzutreiben.
Die Europäer waren angetan. Als der Gouverneur später den renommierten britisch-ghanaischen Architekten David Adjaye für den Bau gewann, waren sie vom Projekt überzeugt.
Unter dem Dach des neuen Museums sollen nicht nur die alten Meisterwerke Platz finden. Es sollen auch zeitgenössische Künstlerinnen ihre Werke zeigen, Wissenschafter sich austauschen und Normalbürger heiraten können. Ein neues Quartier soll entstehen, mitten in Benin City. Fusswege sollen das neue und das alte Museum verbinden und zur alten Stadtmauer führen, die von Gras, Kot und Abfall befreit sein wird. Touristen werden kommen, sie werden Hotels und Taxis füllen. Benin City wird prosperieren – und seinen rechtmässigen Platz als kulturelles Zentrum von Nigeria und ganz Afrika einnehmen.
Das ist die Vision. Das Fundraising läuft bald an. Bis Ende Jahr soll ein Pavillon stehen, als temporäres Gebäude. Bis 2025 soll das Museum fertig sein.
Theophilus Umogbai, der Kurator jenes Museums, das für nicht gut genug befunden worden war, teilt den Traum. Er sagt, das Emowaa-Projekt habe den Europäern Vertrauen eingeflösst. «Früher herrschte ein ohrenbetäubendes Schweigen bei der Frage der Repatriierung», sagt er. Nun habe ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und wenn die Bronzen zurückkehrten, werde endlich die Lücke geschlossen, die ihr Raub in die Geschichte der Stadt gerissen habe.
Hier soll das neue Museum entstehen.
smi. / NZZ
Längst nicht alle lassen sich von der Vision davontragen. Es gibt in Nigeria und in Benin City auch viele Zweifler.
Die Geschichtskundigen unter ihnen erinnern daran, dass die Geschichte Afrikas und Nigerias voller Bauruinen und nie umgesetzter Entwicklungspläne ist.
Die Wirtschaftsverständigen unter ihnen mahnen, dass Nigeria das Gegenteil einer Tourismusdestination ist. Die Strasse, die die Metropole Lagos mit Benin City verbindet, ist notorisch unsicher. Wer es sich leisten kann, legt die dreihundert Kilometer im Flieger zurück, um nicht überfallen zu werden.
Die Kunstverständigen monieren, dass sich die Restitutionsdebatte nur um die ikonischen Objekte dreht. Eine Kuratorin in Lagos sagt, eher als darum, wer denn nun die Bronzen besitze, sollte es darum gehen, wie man kulturelles Erbe breiter zugänglich machen könne. Tatsächlich besitzen Nigerias Museen eine der bedeutendsten Benin-Sammlungen weltweit – doch die allermeisten Objekte liegen in dunklen Lagerräumen.
Auf jeden Fall spielen die Verfechter des Traums mit hohem Einsatz. Sie haben die deutsche Regierung davon überzeugt, Benin-Objekte zurückzugeben. Sie haben das British Museum, eine der grössten und mächtigsten Institutionen dieser Art, in einen permanenten Erklärungsnotstand versetzt.
Was, wenn es schiefläuft?
Mitte Mai hat der König von Benin ein Statement veröffentlicht, in dem er verkündete, er verweigere dem Museumsprojekt in der geplanten Form seine Unterstützung. Es ist ein Streit zwischen dem Palast und dem Gouverneur. Vielleicht ist es nur eine kurze Rangelei unter grossen Egos, vielleicht ist es mehr. Auf jeden Fall ist der Traum fragiler, als seine Anhänger zugeben.
Ein «World Heritage Site», das keines ist
Wer besser verstehen will, was der Traum von der Renaissance für Benin City bedeuten könnte, muss jene besuchen, denen 1897 die Vorbilder für ihre Arbeit gestohlen wurden: die Bronzekünstler. Es gibt in Benin City noch immer etwa zweihundert Bronzegiesser, ihre Werkstätten liegen an der Igun Street, einer drei Kilometer langen Strasse, die gleich gegenüber von Enotie Ogbebors Studio beginnt.
Weltkulturerbe? Der Eingang zur Igun Street.
Akintunde Akinleye / Reuters
Die Igun Street mit den Bronzekünstlern beginnt gleich um die Ecke des Kings Squares
Nationalmuseum von Benin City
Standort des geplanten neuen Museums
«World Heritage Site» steht auf einem Bogen, der sich über den Eingang spannt. Doch die Strasse steht auf keiner Unesco-Liste. Viele sagen: Die Bronzekunst in Benin City ist nur noch ein Abklatsch dessen, was die Künstler des Königreichs vor Hunderten von Jahren schufen.
Phil Omodamwen ist eine Ausnahme, er gilt als einer der besten Bronzekünstler der Stadt. Seine Werkstatt liegt nicht an der Igun Street, sondern ein paar Kilometer nördlich des Zentrums. Ein Dutzend Männer kauern unter Palmen und einem Wellblechverschlag; sie kneten Ton, streichen die Gesichter von Büsten zurecht, hämmern Verzierungen in fast fertige Skulpturen. Dicke Rauchwolken steigen aus einem Loch im Boden, darin schmilzt Metall.
Phil Omodamwen
«Wir haben gebetet, dass die Bronzen zurückkommen», sagt Omodamwen, während er sich einen Weg durch die Werkstatt bahnt. Der 50-Jährige spricht leise, das Kreischen einer Fräse übertönt ihn beinahe. Auch Omodamwen hat einst das British Museum besucht, 1990 war das. «Sie verlangten Eintritt von mir, damit ich unsere Werke sehen konnte», sagt er. Er empfindet das auch drei Jahrzehnte später noch als Unrecht.
Omodamwen wünscht sich die Rückkehr, und doch gehört er zu jenen, die nicht an die Renaissance glauben. Er bezweifelt, dass die Bronzegiesser wieder grosse Werke schaffen, wenn sie die alten Meisterwerke betrachten können. «Wem an der Tradition liegt», sagt Omodamwen, «der macht schon jetzt gute Arbeit.»
Omodamwen liebt seine Arbeit, doch wenn er über das Metier spricht, klingt er nach Endzeit. Es sieht so aus, als ob er in seiner Familie der letzte seiner Art ist. Das Bronze-Handwerk wird vom Vater an den Sohn übergeben, bei den Omodamwens seit sechs Generationen. Doch Phil Omodamwens Söhne, 20 und 22, halten das Giessen für Plackerei; sie studieren Informatik und Rechnungswesen. Später wollen sie mit Aktien handeln.
Nur noch ein Abklatsch dessen, was die Vorfahren schufen? Ein Bronzegiesser an der Igun Street bei der Arbeit.
Akintunde Akinleye / Reuters
Phil Omodamwen tut das weh, doch er hat auch Verständnis. Früher schufen die Bronzegiesser ihre Werke für den Palast, dieser sorgte für den Unterhalt. Heute schlagen sich die Künstler in einer Volkswirtschaft durch, in der fast die Hälfte der Bevölkerung mit weniger als zwei Dollar pro Tag überlebt. Omodamwen gehört zu den Privilegierten. Er verkauft an Expats in Lagos und an reiche Nigerianer. In der Werkstatt steht eine Gruppe von Statuen, für die eine ehemalige Parlamentsabgeordnete über 30 000 Franken bezahlt. Aber selbst Omodamwen sagt: «Ich schlage mich gerade so durch.»
Mehr als zwanzig von Omodamwens Cousins hatten genug davon, sich durchzuschlagen. Sie gingen nach Europa, dort putzen sie nun Büroräume oder arbeiten in Fabriken. Vier sind auf dem Weg verschwunden, im Mittelmeer und in der Sahara. Ihre Leichen wurden nie gefunden. «Es gibt hier keine guten Strassen, es gibt häufig keinen Strom», sagt Phil Omodamwen. Das werde sich nicht ändern, wenn die alten Werke wieder da seien: «Die Bronzen werden den Leuten keine Jobs geben.»
Geht man den einstöckigen Lehmhäusern entlang, die sich an der Igun Street reihen, wird man nicht hoffnungsvoller. Hinter den Häusern liegen die Werkstätten, davor verkaufen die Künstler ihre Ware: Büsten von Königen und Königinnen, die Gesichtszüge manchmal etwas krumm, daneben Holzgiraffen, Bob-Marley-Bilder, Schlüsselanhänger. Vor ein paar Jahren haben einige der Giesser damit begonnen, Plastiktische und Stühle vor die Häuser zu stellen und Bier auszuschenken. Es sieht nun aus wie in einer Strasse für Rucksacktouristen irgendwo auf der Welt. Nur dass es hier kaum Touristen gibt.
Die meisten Giesser haben noch nie vom Emowaa gehört, dem Museum, das ihr Leben verändern soll. Sie zerbrechen sich auch nicht den Kopf darüber, ob die Werke, die ihre Vorfahren geschaffen haben, nach Nigeria zurückkehren werden. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, sich von Tag zu Tag zu hangeln. An der Igun Street hat der Traum von der Renaissance noch nicht verfangen.
Doch es gibt mindestens eine Ausnahme.
Ein Meisterwerk
Chief Kingsleys Haus ist grösser als die meisten in der Strasse, das entspricht seinem Status. Er ist der Chef der Gilde der Giesser. «Es gibt keine Geschichte von Benin ohne die Gilde», sagt Chief Kingsley, sie sei so alt wie das Königreich. Er trägt ein weisses traditionelles Gewand, eine Halskette und ein Armband aus oranger Koralle – auch das ist ein Zeichen seiner Würde.
Ein Bronzekünstler in seiner Werkstatt an der Igun Street.
Akintunde Akinleye / Reuters
Tatsächlich seien die Zeiten nicht einfach, sagt Chief Kingsley. Der Kilopreis für das Messing habe sich verdreifacht. Doch die Leier von der schlechten Qualität der Werke mag er nicht mehr hören. Zu viel Aufmerksamkeit gelte den alten Bronzen, das sei schon immer so gewesen.
Und doch kann das geplante Museum für ihn nicht schnell genug gebaut werden: «Wenn es öffnet», sagt er, «werden die Besucher wissen wollen, wo diese Werke produziert werden. Sie werden zu uns kommen, werden kaufen wollen. Wir werden enorm profitieren.» Chief Kingsleys Vision von der Renaissance ist nicht in erster Linie kulturell, sie ist ökonomisch. Denn das ist das, was seine Leute beschäftigt.
Den bisher deutlichsten Beleg dafür, dass die Renaissance real sein könnte, hat Chief Kingsley selber geschaffen. Er steht in seinem Hinterhof, hinter einem hohen Tor aus Wellblech. Es ist die Statue einer Königin, sechs Meter hoch, über eine Tonne schwer. Der König persönlich hat sie in Auftrag gegeben, sie soll auf einem Kreisverkehr am Stadteingang zu stehen kommen. Bald wird sie enthüllt.
Chief Kingsley sagt, das sei die grösste Bronzestatue, die in Nigeria je gegossen worden sei, ja in ganz Westafrika. Sie sei: ein Meisterwerk.
Und dieses Werk soll erst der Anfang sein. Bereits hat Chief Kingsley 32 weitere Standorte in der Stadt identifiziert, an denen man ähnlich grosse Statuen aufstellen könnte.
Wichtigste Quelle für historische Fakten und Anekdoten in diesem Text ist das im März 2021 erschienene Buch «Loot: Britain and the Benin Bronzes» von Barnaby Phillips. Eine deutsche Übersetzung ist laut dem Autor noch nicht in Planung.
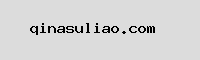

Author: Joshua Martin
Last Updated: 1703148722
Views: 1384
Rating: 4.9 / 5 (112 voted)
Reviews: 89% of readers found this page helpful
Name: Joshua Martin
Birthday: 1978-02-04
Address: 66720 Michelle Pass Suite 325, Port Patrickshire, MO 96175
Phone: +4220208679926918
Job: Environmental Scientist
Hobby: Yoga, Meditation, Skiing, Telescope Building, Orienteering, Animation, Chess
Introduction: My name is Joshua Martin, I am a unguarded, persistent, strong-willed, spirited, steadfast, striking, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.